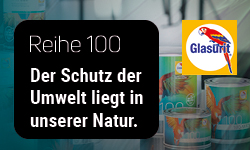Man staunt jedes Mal aufs Neue: Der Heilsbringer der Elektromobilität beginnt seine Karriere als Umweltbremse. Die Batterie, hochgejubelt als technisches Wunder, entpuppt sich erst einmal als schwerer Rucksack voller Emissionen, Kosten und ungelöster Fragen. Nachhaltigkeit? Vielleicht später. Im ersten Akt dominiert die Ernüchterung.
Der TCS seziert das Thema nüchtern. Die Herstellung eines E-Autos belastet die Umwelt deutlich stärker als die eines Verbrenners, vor allem wegen der Batterieproduktion. Trotzdem fährt das E-Auto dem Fossilmobil im Alltag schrittweise davon. Nach 200’000 Kilometern stehen rund 50 Prozent weniger Treibhausgase zu Buche. Mit Schweizer Strom geladen, holt ein durchschnittliches Modell seinen ökologischen Startnachteil nach etwa 50’000 Kilometern ein. Die Restemissionen stammen vor allem aus Wartung, Infrastruktur und ein wenig aus der Stromproduktion. Man könnte sagen: Der Antrieb schweigt sauber – der Rest bleibt laut.
Dass die Schweiz inzwischen knapp ein Drittel ihrer Neuwagen mit Stecker ausliefert, erhöht den Druck auf die zentrale Frage: Was passiert mit den Batterien – und wie lange halten sie überhaupt? Forschung und Industrie drängen auf Antworten. Genau hier setzt «CircuBAT» an, ein Forschungsprojekt, das den gesamten Lebenszyklus von E-Auto-Batterien neu denkt – von der effizienteren Produktion über Reparatur- und Wiederverwendungskonzepte bis zum hochpräzisen Recycling. Kurz: «CircuBAT» untersucht, wie der Batteriekreislauf wirklich geschlossen werden kann, statt ihn nur zu verwalten. An der Tagung in Bern präsentiert das Konsortium aus Hochschulen, Unternehmen und Verbänden diese Woche die Ergebnisse der vergangenen vier Jahre. «Wir wollen den Batteriekreislauf schliessen», heisst es dort sinngemäss – eine Absichtserklärung, die gleichzeitig Vision und heimliches Schuldeingeständnis ist. Denn Optimierung ist nötig. Die Branche weiss es.
Recyclingfirmen in der Schweiz zeigen, dass sie bereit sind. Bis zu 97 Prozent der Aktivmaterialien lassen sich zurückgewinnen. Das übertrifft sogar die EU-Vorgabe von 95 Prozent bis 2031 – ein seltener Moment, in dem Regulierung hinter der Realität herläuft. Die Aussicht klingt verlockend: Weniger Rohstoffe aus kritischen Ländern, weniger Abhängigkeiten, weniger Preislotterie. Doch die Euphorie bleibt verhalten. Der Akku frisst weiterhin bis zur Hälfte der Fahrzeugkosten, getrieben von schwankenden Rohstoffpreisen und globalen Lieferketten, die sich selten an europäische Befindlichkeiten halten.
Technische Alternativen wie Natrium-Ionen-Batterien tauchen am Horizont auf, wirken aber eher wie nette Nebenfiguren in einem Stück, dessen Hauptrollen weiterhin Lithium, Nickel und Kobalt besetzen. Im Roller oder Kleinstwagen mag das funktionieren. In der Mittelklasse genügt es nicht. «Für die grossen Fahrzeuge bleibt Lithium die dominante Technologie», heisst es trocken – und niemand widerspricht.
Interessant wird es ab 2035. Dann könnte recyceltes Material bis zu 30 Prozent des europäischen Bedarfs an Lithium, Nickel und Kobalt decken. Das verändert die Gleichung: bessere Umweltbilanz, sinkende Herstellungskosten, vielleicht sogar eine eigene europäische Batterieindustrie. Ein Kontinent, der seine Abhängigkeiten gerne dramatisiert, sieht plötzlich Chancen. Ironischerweise ausgerechnet dort, wo einst der grösste Vorwurf lag: bei der schwerfälligen, teuren, rohstoffhungrigen Batterie.
Am Ende bleibt die Frage: Ist das das lang ersehnte «neue Leben» alter Batterien – oder nur die nächste Etappe auf einem Weg, der sich ständig selbst korrigieren muss? Die Pointe liefert die Branche selbst. Sie recycelt, optimiert und rechnet, während die Diskussion längst weiterzieht. Doch genau darin liegt der Reiz: Die Batterie bleibt Problem und Lösung zugleich. Ein widerspenstiger Held, der erst im dritten Akt glänzt.