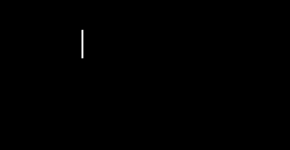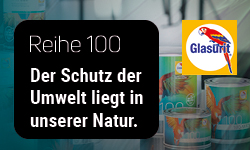Von Dennis Schneider (Text)
Zehn Millionen Mal. So oft hat Suzuki seinen Swift inzwischen unters Volk gebracht. Eine Zahl, die klingt wie ein Triumph, tatsächlich aber vor allem eines zeigt: die unerschütterliche Geduld von Millionen Autofahrern, die sich seit 2004 für denselben Kleinwagen entschieden haben. Der Swift fährt seit zwanzig Jahren durch die Welt, vom japanischen Werk bis zu den Strassen Ghanas, und wirkt dabei wie ein Dauerabonnement auf Mittelmass – zuverlässig, aber nie aufregend.
Sein Geheimnis? Vor allem Indien. Dort ist der Swift kein Auto, sondern eine Institution. Rund sechs Millionen Exemplare rollen dort seit 2005 vom Band, ein Marktanteil, der das Modell zum unangefochtenen Platzhirsch macht. Europa steuert 14 Prozent bei, Japan 8 Prozent, der Rest verteilt sich auf 170 Länder – auch die Schweiz, wo er mit Allradantrieb und «Alltagstauglichkeit» lockt. Ein globaler Bestseller, der keiner werden wollte und trotzdem einer ist.
«Wir bedanken uns bei unseren Kunden weltweit», sagt Toshihiro Suzuki, Präsident der Marke. Als sei die Kundschaft ein anonymer Fanclub, der mit jedem Kauf brav das Überleben des Modells sichert. In Wahrheit ist es die simple Logik: ein günstiger Kompakter, der sich auf fast jedem Kontinent verkaufen lässt, egal ob in Tokio, Delhi oder Safenwil. Dass der Swift gleichzeitig als erstes Suzuki-Modell fast zeitgleich in vier Ländern gebaut wurde, gilt im Unternehmen als strategischer Geniestreich. Andere würden es schlicht effiziente Massenproduktion nennen.
Jetzt also Generation sieben. Ein bisschen markanter im Design, ein bisschen mehr Assistenzsysteme, ein 1,2-Liter-Mildhybrid – Fortschritt in homöopathischen Dosen. Suzuki verspricht «Fahrspass» und «japanische Präzision», als wäre der Swift plötzlich ein Sportwagen oder eine Ikone der Ingenieurskunst. Tatsächlich bleibt er, was er immer war: ein pragmatisches Auto für Menschen, die weder auffallen noch diskutieren wollen. Und vielleicht liegt genau darin seine stille, unaufgeregte Radikalität – zehn Millionen Käufer können nicht irren. Oder doch?