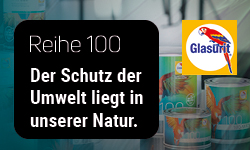Der Energiehunger moderner Autos wächst unaufhaltsam. Während Benziner im Schnitt auf 7,4 Liter pro 100 Kilometer kommen und E-Autos rund 15 Kilowattstunden benötigen, denkt kaum jemand an den Stromverbrauch jenseits des Motors. Doch Assistenzsysteme, Infotainment, vernetzte Dienste und Komfortfunktionen ziehen permanent Strom – und treiben den Bedarf seit den 1990er-Jahren nach oben. Das Problem: Die Energie im Auto ist endlich. Wer sie verschwenden will, muss an der Steckdose wohnen.
Die Fahrzeugbatterie ist längst nicht mehr nur für den Motorstart zuständig. Sie muss ein immer komplexeres Bordnetz versorgen. Klassische Blei-Säure-Batterien stossen hier schnell an ihre Grenzen, besonders bei Start-Stopp-Systemen. Deshalb setzen Hersteller zunehmend auf Enhanced Flooded Battery (EFB) mit beschichteten Platten, die haltbarer und zyklenfester sind. Mehr Technik erfordert robustere Speicher – und bessere Pflege.
«Wartungsfrei» ist ein Marketingversprechen, kein Naturgesetz. Schmutz und Oxid an den Polen mindern die Leitfähigkeit, Kriechströme entladen die Batterie unbemerkt. Wer Stromfresser im Stand laufen lässt, killt den Akku schneller als jede Kältewelle. Regelmässige Reinigung, sparsamer Verbrauch unterwegs und bei Bedarf ein Erhaltungsladegerät verlängern die Lebensdauer – besonders bei Kurzstrecken im Winter.
Die nächste Evolutionsstufe steht bereits vor der Tür: Feststoffbatterien. Sie ersetzen den flüssigen Elektrolyten durch ein festes, nicht brennbares Material. Das erlaubt den Einsatz leistungsfähigerer Anoden aus Lithium oder Silizium – mit höherer Energiedichte und mehr Sicherheit. Für E-Autos bedeutet das grössere Reichweiten, für konventionelle Fahrzeuge effizientere Stromversorgung. Die Richtung ist klar: Energie verschwenden war gestern, künftig zählt, was man aus jeder gespeicherten Kilowattstunde herausholt.