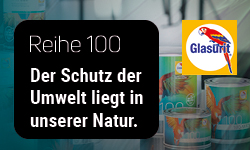Von Dennis Schneider (Text)
Enzo Santarsiero, Managing Director von «Axalta Coating Systems Switzerland», begrüsste kürzlich rund zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Hotel La Perla in Sant’Antonino. Ein Tisch, ein Beamer, zwanzig Menschen, die wissen, wovon sie sprechen. Das achte Erfahrungstreffen von Helvetia ist kein Branchenevent mit Sektglas, sondern ein informativer Workshop über das, was Werkstätten und Versicherer tatsächlich täglich beschäftigt.
Den Anfang macht Pierre-Marie Providoli, Teamleiter Fahrzeugspezialisten bei Helvetia im Tessin und in der Romandie. Sein Vortrag kreist um die anstehende Fusion von Helvetia und Baloise – ein umfassendes Thema. Bis zum 5. Dezember 2025 bleiben beide Unternehmen eigenständig, die Partnerverträge unverändert. Für die Betriebe bedeutet das: sauber weiterarbeiten.
Dann der Dauerbrenner Hagel. Helvetia setzt seit zwei Jahren auf das ADI-Drive-Scan-System. Zwei Partner in der Deutschschweiz verfügen bereits über eigene Scanner, ein dritter Testlauf läuft bei Carrosserie Eugster. Ziel ist ein landesweites Netz, das die Schadenerfassung standardisiert. Im Tessin fehlt noch ein Partner mit Scanner, genutzt wird derzeit die Anlage vom «Xpertcenter» in Camorino. Einheitliche Stundenpauschale: keine Diskussionen im Nachhinein, «diese müssen vor Reparaturbeginn stattfinden», betont Providoli, «nachträgliche Änderungen sind ausgeschlossen.» Probleme entstehen vor allem bei externen Reparaturen: zu viele Dellen, zu wenig Qualität, zu viel Teileaustausch.
Auch bei den Abläufen zeigt sich Helvetia streng, aber klar. Fotos in hoher Qualität, Freigabe vor Arbeitsbeginn, Kalkulationen nur aus «Silver Dat» oder «Audatex», digital eingereicht über E-Service oder EC2. Preisänderungen? Nur mit neuer Einreichung. Selbstbehalte und Mehrwertsteuerabzüge? Nicht Sache der Werkstätten. «Das verursacht nur Mehraufwand in der internen Bearbeitung», sagt Providoli. Reklamationen sieht er nicht als Störung, sondern als Werkzeug zur Verbesserung. «Zweifel sollen direkt mit dem Experten geklärt werden.» Helvetia übernimmt die Kundenkommunikation, damit alles transparent bleibt.
Beim Thema Partnerschaft zählt Verlässlichkeit. Wer überlastet ist oder Ferien plant, soll das früh melden. Telefonate gelten als Notlösung, bevorzugt wird digitale Kommunikation. Nachhaltigkeit zeigt sich im Detail: Garantien werden nur noch digital verarbeitet, Papier ist passé. Zum Schluss richtet Providoli den Blick auf «Repanet Suisse», auf Ausbildung, auf Nachwuchs. Fachkräfte fehlen, Wissen soll geteilt werden. Kein Appell, eher eine Mahnung mit praktischem Unterton.
Dann übernimmt wieder Enzo Santarsiero. Er übermittelt dieses Mal Botschaften, untermauert von Zahlen, und zeigt, was Werkstätten längst spüren: Die durchschnittliche Bruttokalkulation liegt 2024 bei rund 3'000 Franken. Seit 2021 geht der Trend aufwärts. Werkstätten arbeiten effizienter, Margen schrumpfen. Der Markt wird präziser, aber auch enger.
Ein Thema, das Santarsiero besonders betont, ist Energie. Ein weiteres Projekt der Helvetia für ihre Partnerbetriebe ist die Senkung des Verbrauchs fossiler Energiequellen. Die ersten Pilotbetriebe konnten in den vergangenen vier Jahren eine Reduktion von rund 40 Prozent nachweisen. Möglich unter anderem durch Wärmerückgewinnung, effiziente Kabinensysteme und LED-Beleuchtung. Eine Standard-Lackierkabine verbraucht heute etwa 20 Kilowattstunden Strom und sechs bis neun Liter Öl – über 50 Prozent weniger als früher. «Fortschritt bedeutet nicht, laut zu werden, sondern präziser zu arbeiten», sagt Santarsiero. Förderungen von ColorWatt, einem Programm von ProKilowatt vom Bundesamt für Energie, von bis zu 30 Prozent der Investitionskosten sind möglich, maximal 300'000 Franken. Ein Beispiel liefert die DIMAB-Gruppe: neue Lackieranlage, rund 40 Prozent weniger Stromverbrauch, Subvention gut 24'000 Franken.
Auch Ausbildung bleibt Thema. Kurse zu Hochvolt, Kältemittel oder ADAS-Systemen, maximal zwölf Teilnehmende pro Tag. Kein Showtraining, sondern Fachwissen auf Werkstattniveau. Anschliessend zeigt Santo Tallarico, Verkaufsberater bei Axalta – André Koch, wie Effizienz konkret aussieht. Kein Marketing, sondern Mathematik. Sein Beispiel: der SmartBoxBlower von Cartec. Mit dem System sinkt die Arbeitszeit von 40 auf weniger als 10 Minuten pro Durchlauf. Drei Arbeitsdurchgänge pro Tag, rund 660 pro Jahr. «Die Investition amortisiert sich in knapp 14 Monaten», sagt Tallarico. Nicht Werbespruch, sondern reine Berechnung.
Dazu das neue Axalta-Lacksystem «Fast Cure Low Energy (FCLE)-System» halbiert Energieverbrauch und CO₂-Ausstoss, verkürzt die Durchlaufzeiten und steigert so die Produktivität. Der neue «Zwei-in-Eins»-Füller spart Schleifvorgänge, Material und Zeit. Die Botschaft: Fortschritt ohne Lärm, Effizienz statt Etikett. Einer der Teilnehmer fasst es zusammen: «Wir reden nicht über Nachhaltigkeit, wir rechnen sie durch.»
Zum Abschluss folgt der Workshop. Zwei Gruppen, zwei Perspektiven, ein Ziel: Praxis statt Pathos. Gruppe 1, vorgestellt von Marco Bottarini, setzt auf Effizienz – alternative Reparatursysteme, Scanner, Blower, Spot Repair, Kunststoffinstandsetzung. Kundenkommunikation als Haltung: zuhören, erklären, Vorschläge machen. Kleine Anreize – Politur, Nanoversiegelung, Feedbackbögen – sollen Nähe schaffen. Gruppe 2, präsentiert von Leonardo Monzeglio, denkt in Spezialisierungen: Felgenreparatur, Glas, Scheinwerfer, Radarsysteme. Dazu der Appell, Lehrlinge auszubilden, Wissen zu teilen.
Das Ergebnis: kein Innovationszirkus, sondern ehrliche Betriebsdiagnose. Weniger Pathos, mehr Prozess. Ein Treffen, das keine Schlagzeilen produziert, aber Klarheit schafft – und in einer Branche, die zwischen Fusion, Fachkräftemangel und Effizienzdruck steht, ist das vielleicht die wichtigste Währung.